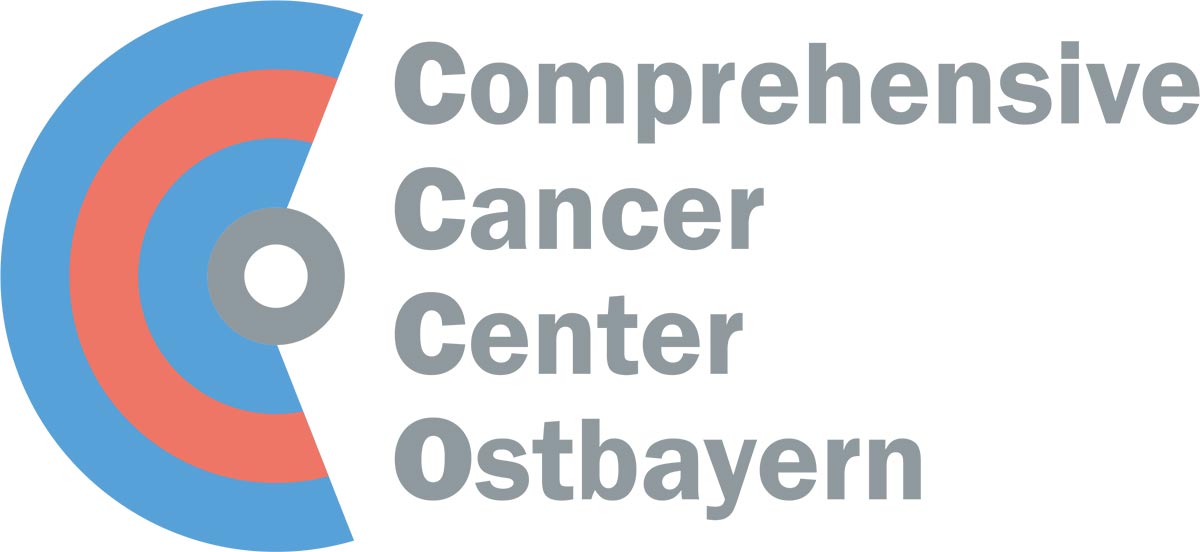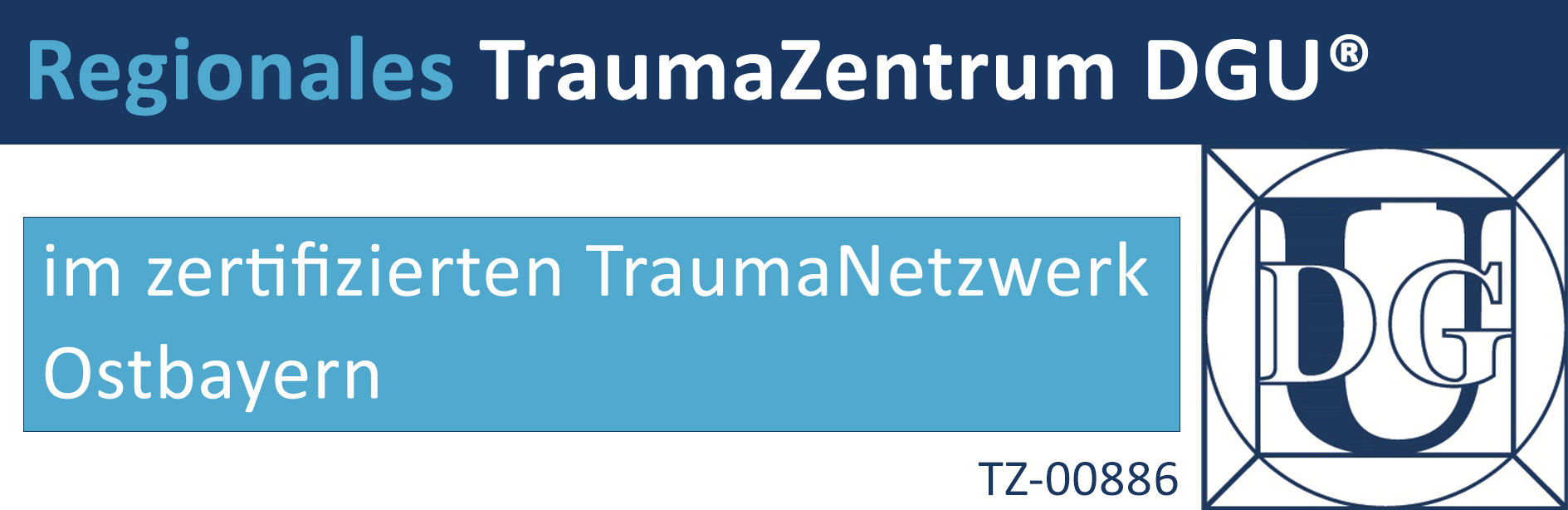Assistenzärzte. Klischees über die Berufsgruppe gibt es zuhauf: die halten vielleicht mal einen Haken, holen Akten und sind überdies arrogant dem Pflegepersonal gegenüber. Und überhaupt: „Wann werden die zu richtigen Ärzten?“
Wir halten nicht viel von Klischees und machen uns lieber ein eigenes Bild. Deshalb haben wir zwei junge Ärztinnen in Weiterbildung begleitet. Und was sollen wir sagen: die beiden haben in nur wenigen Minuten so ziemlich jedes Klischee widerlegt.
Ms. Multitasking
Dr. Susanne K. – Assistenzärztin der Klinik für Allgemeinchirurgie und Unfallchirurgie
Es ist 10:30 Uhr, der Zwischendienst in der Zentralen Notaufnahme beginnt. Am Stützpunkt kommt eine junge Frau mit festen Schritten auf mich zu, der Blick ist offen, die Ausstrahlung präsent: Dr. Susanne K. Die Assistenzärztin im fünften Jahr betreut heute die allgemein- und unfallchirurgischen Patienten in der ZNA. Dort herrscht bereits reges Treiben: Türen öffnen und schließen sich, Patienten kommen und gehen, Mitarbeitende eilen über die Flure. Am Stützpunkt, an dem sich ein Computer an den nächsten reiht, ist beinahe jeder Platz besetzt. Während Dr. K. einen der letzten freien Monitorplätze ergattert, erklärt sie: „Ich verschaffe mir einen Überblick, welche Patienten aus meinem Bereich noch nicht versorgt werden.“ Alle Patienten sind elektronisch erfasst und Fachbereichen zugeordnet. „Damit weiß ich auf einen Blick, wer noch nicht von einem Arzt gesehen wurde. Hier zum Beispiel, in der 5, da liegt eine ältere Dame, die der Rettungsdienst zu uns gebracht hat. Darum kümmere ich mich gleich mal.“
Bevor sie sich auf den Weg ins Behandlungszimmer macht, wirft sie noch einmal einen Blick auf den Monitor. „Ich finde online sowohl die Informationen, die der Rettungsdienst uns gegeben hat wie auch Daten aus unserem Haus, falls die Dame schon einmal bei uns war“, erklärt Dr. K.. Die Frage beantwortet die rüstige Seniorin selbst als die junge Ärztin ins Zimmer kommt: „Ich war noch nie im Krankenhaus, ich bin gestürzt und weiß gar nicht, wie das passieren konnte.“ Ihre Lippe blutet, sie hat eine Beule am Kopf, das Fußgelenk ist dick und blau. Dr. K. stellt sich der Patientin vor und stellt ihr behutsam einige Fragen, während sie das verletzte Gelenk mit äußerster Vorsicht abtastet. Dabei zuckt die Patientin immer wieder vor Schmerz zusammen. „Gleich haben Sie es geschafft“, ermutigt die junge Frau sie und erklärt kurz darauf: „Ihr Sprunggelenk ist ziemlich instabil, wir legen Ihnen jetzt erst einmal einen Gipsverband an.“ Sie hält Fuß und Bein in der richtigen Position, während die Pflegefachkraft den Gips anlegt. Dabei fragt sie die Patientin immer wieder „Geht´s von den Schmerzen?“ Als das Bein versorgt ist, gibt Dr. K. in der Radiologie Bescheid und erklärt der Seniorin: „Nach dem Röntgen wissen wir mehr. Leider kann ich nicht ausschließen, dass wir operieren müssen.“ Sie eilt zurück zum Stützpunkt, dort dokumentiert sie den Behandlungsfortschritt und erklärt mir, dass die Entscheidung für eine Operation nur von einem Oberarzt getroffen werden darf.
Ins kalte Wasser geworfen
Doch auch, wenn sie noch keine OP-Indikation stellen darf, sieht alles andere ebenfalls nach viel Verantwortung aus. Wie geht man damit um bzw. wie war es direkt nach dem Studium für sie? „Vieles ist tatsächlich `learning by doing´“, sagt die 30-Jährige. „Man wird am Anfang schon ins kalte Wasser geworfen, aber es ist immer jemand da, den man fragen kann. Doch auch nach Jahren lernt man nie aus und ich finde es sehr schön, dass wir uns im Team gegenseitig unterstützen und auch die Oberärzte bzw. der Chefarzt immer ansprechbar sind. Ich halte den Zusammenhalt und die enge und gute Zusammenarbeit hier im Haus schon für etwas Besonderes.“ Noch während wir sprechen, sucht Dr. K. den nächsten Patienten auf: Es ist ein 78-jähriger Mann. Er hatte vor Kurzem eine Leistenbruch-OP, jetzt zeigt sich im Bereich des Eingriffs eine dicke Beule. Auch hier fällt mir auf, wie umfassend Dr. K. den Patienten befragt und ihm alles ganz genau und freundlich erklärt. „Es könnte sein, dass es reicht, wenn wir Sie punktieren, eventuell muss noch einmal operiert werden“, berichtet sie ihm. Zurück am Stützpunkt ruft sie den Oberarzt, der die OP-Entscheidung treffen muss.
Die Taktung in der ZNA ist selbst an einem normalen Tag sehr hoch, ständig kommen neue Patienten an, mehrere wollen gleichzeitig versorgt werden, dann noch die Abstimmung mit den Oberärzten. Wie gelingt es, hier den Überblick zu behalten? „Man muss schon sehr organisiert sein, aber das lernt man auch durch die Tätigkeit auf Station. Und generell gilt natürlich: nur so viele Patienten annehmen, wie man im Überblick behalten kann“, erklärt Dr. K. mir. Dass sie das kann, den Überblick behalten, ist schnell klar. Man könnte sie wohl auch Ms. Multitasking nennen. Telefonieren, tippen und Fragen beantworten, all das scheint bei ihr ohne Probleme gleichzeitig möglich zu sein. Und doch wirkt sie nie abgelenkt, immer sehr gewissenhaft.
Als der Leitende Oberarzt Dr. Arthur H. da ist, berichtet sie kurz, knapp und sehr präzise über die Patienten, die sie gemeinsam noch einmal besuchen. Der Herr mit der Beule in der Leiste muss tatsächlich noch einmal operiert werden, auch für die Dame mit dem Sturz steht eine OP an, eine weitere Patientin mit unklaren Bauchschmerzen, die Dr. K. in der letzten Stunde ebenfalls gesehen hat, muss für eine genauere Diagnose ins CT. Ich nutze die Gelegenheit und frage Dr. H., was seiner Meinung nach eine gute Assistenzärztin mitbringen muss: „Resilienz. Wenn einem alles um die Ohren fliegt, muss sie der Fels in der Brandung sein, alles im Griff haben und manche Sachen auch von sich abtropfen lassen können.“ Ich frage Dr. K., wie es ihr gelingt, wie sie mit dem Stress umgeht, den ihre Arbeit zwangsläufig mit sich bringt. „Ich treibe Sport, treffe mich gern mit Familie und Freunden. Aber generell ist es ja so: Wenn man etwas gern tut, dann ist es ja ganz oft positiver Stress. Man geht mit einem guten Gefühl aus der Arbeit.“ Mit einem guten Gefühl verlasse auch ich die Notaufnahme.
Hochkonzentrierte Millimeterarbeit
Dr. Sophia D. – Assistenzärztin in der Klinik für Plastische und Ästhetische, Hand- und Wiederherstellungschirurgie
Wenn Dr. Sophia D. von ihrem Beruf erzählt, beginnen die Augen der 30-Jährigen zu strahlen: „Ich wollte schon immer Ärztin werden. Das ist sicher auch familiär bedingt, mein Papa ist Orthopäde. Mich interessiert allerdings eher das feinere Arbeiten“, berichtet sie mit einem Schmunzeln. „Deshalb möchte ich Fachärztin für Plastische Chirurgie werden.“
Heute ist sie im OP eingeteilt, dann startet ihr Tag um 7:10 Uhr. Gemeinsam mit dem Operateur zeichnet sie die Patienten an, die an diesem Tag operiert werden. Um 7:30 Uhr werden in der gemeinsamen Frühbesprechung die geplanten Eingriffe besprochen. „Meist verlassen wir Assistentinnen und Assistenten die Besprechung etwas früher, um den ersten OP-Punkt vorzubereiten“, erklärt sie mir. Heute steht ein DIEP-Lappen an. Diese mikrochirurgische Brustrekonstruktion mit freien Lappenplastiken ist die Königsdisziplin der Ästhetischen Brustrekonstruktion verrät mir das Internet. Dabei wird ein Hautlappen am Unterbauch samt Arterien- und Venen komplett entfernt und eine weibliche Brust daraus geformt. Damit das Gewebe durchblutet wird, werden die Gefäße des Lappens mikrochirurgisch an die Mammaria interna-Gefäße im Brustbereich angeschlossen. Die Chirurgen arbeiten hier im Millimeterbereich. Dr. D.s Aufgabe an diesem Tag wird es sein, die Mammaria interna-Gefäße freizulegen und so zu präparieren, dass die Gefäße des Hautlappens daran angeschlossen werden können.
Die OP wird sechs bis acht Stunden dauern. Hunger, Durst, Pipi – wie hält man das durch? Dr. Sophia D. lacht: „Das war am Anfang schon ungewohnt, aber es hilft nichts, da muss man durch. Man sollte auf jeden Fall vorher nochmal zur Toilette, aber generell kann man das trainieren und man gewöhnt sich daran. Die Konzentration auf die Operation lässt einen die eigenen Bedürfnisse ein wenig vergessen.“
Während ich noch darüber nachdenke, wie das funktionieren soll, bespricht sich Dr. D. mit ihren Kolleginnen. Bis auf einen männlichen OTA werden heute nur Frauen am Tisch stehen: eine Oberärztin, eine Fachärztin, eine Assistenzärztin und eine PJlerin. Die Frauen gehen die Details des bevorstehenden Eingriffs mit allen Details durch. Danach wird die Patientin abgedeckt und für den Eingriff vorbereitet. „Kann mal jemand mit abwaschen, dann geht es schneller“, ruft die Oberärztin. Dr. D. ist sogleich mit einem Tupfer zur Stelle und unterstützt. Anschließend befestigt sie die Armschienen, korrigiert die Lagerung der Patientin und bandagiert anschließend die Arme, um die Zugänge während der langen OP-Zeit zu schützen. Bei den Vorbereitungen geht alles Hand in Hand, alle kennen ihren Part, ein Rädchen greift ins andere. Doch selbstverständlich ist das nicht, wie die Assistenzärztin mir erklärt. „An das Arbeiten im OP, an die besondere Atmosphäre und das Zusammenspiel der Berufsgruppen muss man sich zu Beginn erst gewöhnen.“ Wenig später als der Eingriff beginnt, wird mir klar, warum. Alle vier Frauen arbeiten gleichzeitig am Oberkörper der Frau – zwei am Bauchraum, zwei im Brustbereich. Hochkonzentriert geht Dr. D. ans Werk. Mit dem elektronischen Messer öffnet sie den Brustkorb der Frau. Die Fachärztin begutachtet jeden Schritt ganz genau, blickt ebenso hochkonzentriert wie Dr. D. auf das OP-Gebiet.
Bis auf wenige Anmerkungen der Fachärztin arbeitet die Assistenzärztin völlig eigenständig. „Das war eine ganz schöne Umstellung im Vergleich zur PJ-Zeit“, erklärt sie mir im Nachgang. „Da darf man mal einen Haken halten, aber mehr nicht. Bei der ersten OP, bei der man eigenständig für einen Teil verantwortlich ist, ist das dann natürlich ganz was anderes. Da merkt man: jetzt trage ich dafür allein die Verantwortung – auch wenn die Oberärzte einen begleiten.“ Ich frage auch sie, wie es ihr damit ging. „Man lernt mit der Zeit, wächst mit seinen Aufgaben“, erklärt sie. Was gut sei: am Anfang stünden vor allem kleinere Sachen wie Metallentfernung oder Vac-Wechsel auf dem Plan. „Das bringt die Routine. Im Lauf der Zeit wird einem immer mehr zugetraut, man lernt viel dazu und darf auch viel selbst machen. Das ist aber auch wichtig. Nur so lernen wir und entwickeln uns weiter, indem wir Verantwortung übernehmen.“ Dennoch habe sie großen Respekt vor ihrer Tätigkeit: „Es muss einen immer bewusst sein: Hier vor mir liegt ein Mensch.“
Empathie, Ehrgeiz und Konzentration
Ich frage sie, welche Eigenschaften sie für ihre Tätigkeit als Assistenzärztin als wichtig erachtet: „Empathie ist im Umgang mit Patienten eine der entscheidenden Eigenschaften für mich. Der Wille und Ehrgeiz, zu lernen und sich ständig weiterzuentwickeln, gehört natürlich auch dazu. Und zu guter Letzt: Konzentrationsfähigkeit. Am OP-Tisch muss man alle anderen Themen, die einen vielleicht gerade beschäftigen ausblenden.“ Das gelte auch dann, wenn Patienten schwer verletzt sind. „In meiner Anfangszeit am UKR habe ich oft auch Patienten gesehen, denen es bei einem Unfall den Arm abgerissen hat. Gerade zu Beginn schluckt man da schon ganz schön. Aber man muss lernen, hier professionell zu werden und das steril zu betrachten. Wenn ich am Tisch stehe, bin ich daher in einer Art Tunnel, denn nur ein Millimeter mehr und ich habe ein Loch in der Vene. Dann hat sich die OP erledigt.“
Zurück zum Saal: dort gibt die Fachärztin gerade Tipps: „Von hier bis da, da würde ich den Muskel aufmachen und zur Seite schieben. Du machst quasi hier einen Querschnitt und einen zweiten. Genau, genau da ist es…“ Dr. D. arbeitet weiter hochkonzentriert an der Freilegung der Mammaria interna-Gefäße. Während für sie die OP noch mehrere Stunden weitergeht, verlasse ich den Saal. Denn genau wie bei Dr. K. ist mir auch hier schnell bewusst geworden, wie daneben die eingangs erwähnten Klischees sind.
Ich durfte zwei Frauen begleiten, deren Verantwortung weit über das „Haken halten“ hinausging. Vielmehr habe ich zwei Ärztinnen erlebt, die mit sehr viel Gewissenhaftigkeit an ihre Aufgabe gehen und die dabei keineswegs arrogant waren, sondern richtig gute Teamplayer. Anders funktioniert es in so einem komplexen System wohl auch nicht. Und auch die anfangs aufgeworfene Frage „Wann kommt denn der richtige Arzt?“ lässt sich leicht beantworten: AssistenzärztInnen sind Ärzte. Sie sind vollwertige Mitglieder der Ärzteschaft. Deshalb hat der Deutsche Ärztetag bereits vor Jahren beschlossen, stattdessen den Begriff Arzt/Ärztin in Weiterbildung zu benutzen.